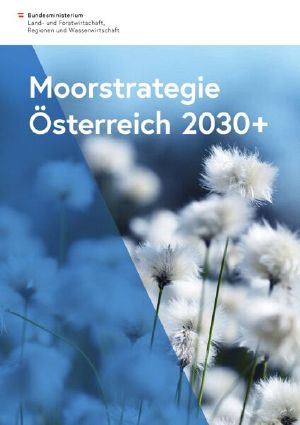Moorstrategie Österreich 2030+
Das Dokument fokussiert sich auf die Strategie zum Schutz, Erhalt und der nachhaltigen Nutzung der Moore und Torfböden in Österreich im Kontext der nationalen und europäischen Umwelt-, Klima- und Naturschutzpolitik. Es verfolgt das Ziel, die Bedeutung der Moore für Ökosystemleistungen, Biodiversität und den Klimaschutz durch umfassende Maßnahmen, rechtliche Rahmenbedingungen und regionale Aktionspläne zu sichern, zu sanieren und wiederherzustellen. Die Zielgruppe umfasst Entscheidungsträger in Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Naturschutzorganisationen sowie Grundeigentümerinnen und -eigenten, die an der Umsetzung und Förderung eines nachhaltigen Moor- und Torfbodenschutzes beteiligt sind.
Zusammenfassung
Impressum
Dieses Kapitel enthält die Kontaktdaten, Autorinnen und Autoren sowie Mitwirkende der Moorstrategie Österreich 2030+. Es listet die beteiligten Institutionen, Personen, Fotografen und das Designer-Team, gibt Hinweise auf die Urheberrechte und verortet die Veröffentlichung in Wien 2022 (ND 2024).
Gemeinsam für den Schutz der Moore
Diese Einleitung hebt die Bedeutung der Moore in Österreich hervor, die vielfältige Ökosystemleistungen bereitstellen, wie Wasserretention, Klimaschutz durch Kohlenstoffbindung und Lebensraum für bedrohte Arten. Die Strategie zielt auf Erhaltung, Wiederherstellung und Bewusstseinsbildung ab, um den dramatischen Rückgang und Zustand der Moore zu adressieren. Es wird betont, dass die Bedeutung der Moore durch internationale, nationale und regionale Zusammenarbeit gestärkt werden muss.
Inhaltsverzeichnis
Das Inhaltsverzeichnis überschlüsselt die Hauptkapitel der Strategie, die sich in fachliche Grundlagen, Ziele und Maßnahmen, Schutz- und Nutzungskonzepte, internationale und nationale Rahmen, Aktionspläne sowie Anhänge gliedern, um den umfassenden Schutz und die nachhaltige Nutzung der Moore in Österreich zu fördern.
Zusammenfassung
Diese Zusammenfassung verdeutlicht die ökologische, kulturelle und klimarelevante Bedeutung der Moore in Österreich. Sie stellt den Rückgang durch menschliche Eingriffe und den Klimawandel dar, betont die Notwendigkeit der Erhaltung und Wiedernutzung der Moore, und fasst die strategischen Zielsetzungen bis 2030 zusammen: Schutz, Wiederherstellung, nachhaltige Nutzung sowie Bewusstseinsbildung.
1. Moore in Österreich
Dieses Kapitel erläutert, was Moore sind, ihre Vielfalt und die ökologischen Moortypen (Niedermoore, Übergangsmoore, Hochmoore, Deckenmoore, Anmoore). Es beschreibt die Verbreitung, typische Arten und die besonderen Bedingungen in Österreich, die die hohe Biodiversität bewahren. Es weist auf die Gefahr durch Entwässerung, Torfabbau und Klimawandel hin und skizziert die Bedeutung von Mooren als Lebensräume und Ressource.
2. Torfböden in Österreich
Hier werden Torfböden als Überreste ehemaliger Moore beschrieben, die durch menschliche Nutzung, vor allem Entwässerung und Bewirtschaftung, entstanden sind. Es erfolgt eine Einordnung in den Kontext der landwirtschaftlichen Nutzung und der Klimaeffekte. Die Verbreitung und die Bedeutung für die Kohlenstoffspeicherung werden unterstrichen, ebenso die Defizite bei Erhebungsdaten.
3. Ökosystemleistungen von Mooren und Torfböden
Dieses Kapitel hebt die vielfältigen Leistungen der Moore hervor, wie Wasserretention, Schutz vor Hochwasser, Klimaregulation durch Kohlenstoffbindung, Kultur- und Kulturhistorie sowie Biodiversität. Es wird die Bedeutung der nachhaltigen Pflege und Nutzung für zukünftige Generationen betont, inklusive regionaler, nationaler und globaler Perspektiven.
4. Was bisher erreicht wurde
Zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Bundesländern demonstrieren den Fortschritt bei Moorrenaturierungen, Schutzmaßnahmen, Bewusstseinsbildung und Naturschutzprojekten. Es werden konkrete Pilotprojekte, Sanierungsinitiativen, Schutzgebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt, die den erhöhten Einsatz für den Moor- und Torfbodenschutz dokumentieren.
5. Strategie: Handlungen im Sinne des Moor- und Torfbodenschutzes
Dieses Kapitel beschreibt die strategischen Handlungsfelder: Grundlegende Voraussetzungen, Erhaltung, Sanierung, nachhaltige Nutzung und Bewusstseinsbildung. Es fordert eine integrative, fachübergreifende Zusammenarbeit, rechtliche Absicherung, Pflege, Monitoring, Aufklärung sowie ökologische und ökonomische Maßnahmen, um die Zielsetzungen bis 2030 und darüber hinaus zu verwirklichen.
6. Der naturschutz- und förderpolitische Rahmen
Es werden die internationalen, europäischen und nationalen Rahmenbedingungen dargestellt, wie die UN Nachhaltigkeitsziele, EU-Biodiversitätsstrategie, Natura 2000, Alpenkonvention, Wasser- und Hochwasserrichtlinien, LULUCF-Verordnung sowie nationale Strategien und Förderungen. Der Fokus liegt auf gesetzlichen Schutz, Schutzgebietsplanung, Klima- und Wasserpolitik sowie der Bedeutung für Biodiversität und Klimaschutz.
7. Aktionspläne der Bundesländer und des Bundes
Dieses Kapitel beschreibt die Umsetzung der Strategie durch konkrete, länderübergreifende und nationale Aktionspläne. Sie beinhalten Maßnahmen wie Renaturierung, Schutzgebietsmanagement, Daten- und Wissenserhebung, Öffentlichkeitsarbeit, Förderprogramme und internationale Kooperationen, um die gesetzten Ziele bis 2030 zu erreichen.
Anhang: Übersicht über Finanzierungsmöglichkeiten
Der Anhang gibt einen Überblick über Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene, die für Moorschutzmaßnahmen genutzt werden können. Darin enthalten sind Förderungen im Rahmen der GAP, LIFE-Programme, Biodiversitätsfonds, Länderspezifische Fonds, private Zertifizierungsprogramme und die Möglichkeiten der Ko-Finanzierung sowie die Voraussetzungen für die Antragstellung.
Anhang: Akteure im Moorschutz
Dieses Kapitel betont die Bedeutung von Zusammenarbeit verschiedener Akteurinnen und Akteure: Ministerien, Landesregierungen, Gemeinden, Wissenschaft, NGOs, Grundeigentümer, Schutzgebiete sowie regionale Organisationen. Es unterstreicht die Notwendigkeit eines integrativen, multidisziplinären Ansatzes und einer vernetzten Zusammenarbeit, um den Moorschutz effektiv voranzubringen.
Anhang: Glossar
Das Glossar erläutert zentrale Begriffe wie Akrotelm, Anmoor, Deckenmoor, Drainage, Erhaltungszustand, Hochmoor, Hydrologische Moortypen, Intesivgrünland, Katotelm, Kohlendioxid, Methan, Moorsackung, Paludikultur, Treibhausgas, Wiedervernässung usw., um die Fachbegriffe der Strategie verständlich zu machen und die es für die Umsetzung und Kommunikation zu nutzen.

Moorstrategie Österreich 2030+ (de)
Seitenanzahl: 142
Zielländer: Österreich
Wichtige Punkte
- Der Schutz und die Wiederherstellung von Mooren sind zentral für Klimaschutz, Hochwasserrückhalt und Biodiversität.
- Intakte Moore speichern Kohlenstoff, wirken als natürliche Wasserspeicher und Lebensraum seltener Arten, was die strategische Bedeutung der Moorrevitalisierung in Österreich unterstreicht.
- Die EU-Strategien (z. B. Biodiversitätsstrategie 2030, Green Deal) setzen den Schutz von Mooren als Kernziel für Biodiversität, Wasser- und Klimaschutz.
- Die österreichische Moorstrategie orientiert sich an diesen europäischen Vorgaben, wobei Schutzmaßnahmen, Renaturierungen und nachhaltige Nutzung gefördert werden, um die EU-Ziele bis 2030 zu erreichen.
- Entwässerung, Überbauung und Nährstoffeinträge sind die Hauptgefährdungsfaktoren für österreichische Moore.
- Diese Einflüsse führen zu Degradierung, Verlust der Biodiversität und Freisetzung von Treibhausgasen, wodurch die Dringlichkeit von Wiedervernässungs- und Schutzprojekten betont wird.
- Wasserhaushalt und hydrologische Sanierungen sind entscheidend für den Erfolg der Moorwiederherstellung.
- Maßnahmen wie Verschlusse alter Entwässerungsgräben und die Wiederherstellung naturnaher Wasserstände sind präventiv und restorativ für die Funktionstüchtigkeit der Moore relevant.
- Die Nutzung und Förderung torffreier Produkte sowie die Reduktion des Torfimports sind essenzielle Maßnahmen im Treibhausgasschutz.
- Die Vermeidung von Torf aus in- und ausländischer Produktion sowie die Etablierung nachhaltiger Alternativen in Gartenbau und Landwirtschaft tragen zur Reduktion von Emissionen bei.
- Das Bewusstsein und die Fachkenntnis im Moorschutz sind durch nationale und internationale Kooperationen sowie Bildungsmaßnahmen zu stärken.
- Aufklärung, Netzwerkarbeit und die Entwicklung von Management-Standards sind Voraussetzung für erfolgreiche Schutz- und Wiederherstellungsprojekte für Moorökosysteme in Österreich.
Quellen
- Moorstrategie Österreich 2030+ - 2022-01-01 - https://life-amoore.at/wp-content/uploads/2024/06/Moorstrategie-Oesterreich-2030_ND2024.pdf