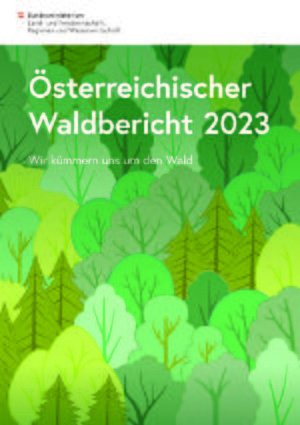“Österreichischer Waldbericht 2023”
Das Dokument ist der „Österreichische Waldbericht 2023“ und verfolgt das Ziel, den aktuellen Zustand, die Entwicklung sowie die zukünftigen Herausforderungen und Chancen der Wälder in Österreich darzustellen. Es soll die vielfältigen Funktionen des Waldes – als Klimaschützer, Biodiversitätslebensraum, Wirtschaftsfaktor und gesellschaftlicher Erholungsraum – verständlich machen und aufzeigen, welche Maßnahmen notwendig sind, um die nachhaltige Bewirtschaftung und den Schutz der Wälder im Kontext des Klimawandels zu sichern. Zielgruppe sind politische Entscheidungsträger, Fachleute in Forstwirtschaft und Umwelt, Wissenschaftler sowie die breite Öffentlichkeit, die an nachhaltiger Waldbewirtschaftung und Umweltschutz interessiert sind.
Zusammenfassung
Vorwort
Der Vorwortabschnitt hebt die Bedeutung des österreichischen Waldes hervor, betont seine vielfältigen Funktionen für das Klima, die Biodiversität und die Gesellschaft und führt die Herausforderungen durch den Klimawandel auf. Es wird die Wichtigkeit nachhaltiger Maßnahmen und öffentlicher Unterstützung für den Schutz und die Weiterentwicklung der Wälder deutlich gemacht.
Inhalt
Der Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über die thematische Struktur des Berichts, inklusive Kapitel zu Wald und Klima, Biodiversität, Wirtschaft, Gesellschaft sowie Zukunftsgestaltung. Es zeigt die umfassende Betrachtung des Waldes in Bezug auf Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft.
Der Wald in Zahlen
Der Abschnitt präsentiert zentrale Daten: Österreichs Wald bedeckt etwa 48 % der Staatsfläche mit mehr als 4 Millionen Hektar, die kontinuierlich zunehmen. Der Holzvorrat steigt, mit einer nachhaltigen Nutzung von rund 89 % des Zuwachses. Laubholz gewinnt an Bedeutung, während Schäden durch Wild verstärkt werden. Zudem wird die Rolle des Totholzes für die Biodiversität hervorgehoben.
Kapitel 1 Wald und Klima
Dieses Kapitel beschreibt die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wälder, wie veränderte Vegetationsperioden, steigende Temperaturen, Schädlinge und die Bedeutung klimafitter Waldwirtschaft. Maßnahmen zur Anpassung, Förderung der Biodiversität und der Einsatz von Holz als nachhaltiger Energieträger werden erörtert.
1.1 Auswirkungen des Klimawandels auf die Wälder
Der Klimawandel führt zu längeren Vegetationszeiten, höherem Wachstum, veränderten Baumartenverbreitungen, aber auch zu Risiken wie Orkanschäden, Schädlingen und Bodenerosion. Die mikrobielle Aktivität in Waldböden ändert sich, was langfristig C-Emissionen verstärken könnte. Maßnahmen zur Erhaltung der Waldgesundheit sind notwendig.
1.2 So gestalten wir den Wald der Zukunft
Zur Zukunftssicherung des Waldes gibt es drei Strategien: Erhaltung und Vitalisierung bestehender Bestände, Anpassung durch standortangepasste Baumarten und gezielte Aufforstung mit resilienten Arten. Nachhaltige Bewirtschaftung und genetische Vielfalt sollen den Wald klimafit machen.
1.3 Der Wald als Klimaschützer
Wälder absorbieren CO2, speichern es im Holz und im Boden. Allerdings ist die Speicherung durch Klimaextreme gefährdet. Nachhaltige Forstwirtschaft und Nutzung des Holzprodukts tragen signifikant zum Klimaschutz bei, wobei der Übergang von einer CO2-Senke zu einer Quelle möglich ist, wenn Wälder sich nicht anpassen.
1.4 Energie aus Holz
Holz gilt als klimaneutral im Energiekreislauf, da es Kohlenstoff bindet, solange es im Produkt verbleibt. Erneuerbare Holzenergie (z.B. Pellets, Hackgut) macht einen bedeutenden Anteil an Österreichs Energieträgern aus. Die nachhaltige Nutzung kann fossile Brennstoffe ersetzen und regionale Wertschöpfung fördern.
1.5 Wald schützt: viele Herausforderungen, starke Lösungen
Schutzwälder sind essenziell für die Sicherheit vor Naturgefahren. Viele Schutzwälder sind durch Wildverbiss und Klimafolgen gefährdet. Das Aktionsprogramm 'Wald schützt uns' und das Schutzwaldzentrum in Traunkirchen unterstützen die nachhaltige Erhaltung der Schutzwälder durch Investitionen, Forschung und Bewusstseinsbildung.
Kapitel 2 Wald und Biodiversität
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Zustand der Biodiversität im Wald, den Maßnahmen zu deren Schutz und den Folgen des Klimawandels. Österreichs Wälder beherbergen eine hohe Artenvielfalt, die durch bewusste Bewirtschaftung, Schutzgebiete und Vernetzung gefördert wird.
2.1 Wie es um die Biodiversität im Wald steht
Die Biodiversität in Österreich ist hoch, mit etwa 68.000 Arten. Der Verlust und die Gefahr durch den Klimawandel erfordern gezielte Maßnahmen wie alte Bäume, Totholz und Mischbestände, um die Artenvielfalt zu erhalten. Der Biodiversitätsindex zeigt eine positive Entwicklung.
2.2 Schützen und Lebensräume wieder verbinden
Landschaftliche Fragmentierung beeinträchtigt die Biodiversität. Durch Trittsteinbiotope, Naturwaldreservate und Vernetzungsmaßnahmen werden Lebensräume wieder verbunden, um Artenwanderung und Genfluss zu fördern. Schutzgebiete wie Nationalparks bewahren nahezu naturbelassene Wälder.
Kapitel 3 Wald und Wirtschaft
Das Kapitel beschreibt Eigentumsverhältnisse, die nachhaltige Nutzung, Holzhandel, Wertschöpfungsketten, Im- und Export sowie innovative Technologien in der Forstwirtschaft. Österreich ist führend im Holzexport und investiert in Forschung und nachhaltige Wertschöpfung.
3.1 Wem gehört Österreichs Wald?
Der österreichische Wald ist größtenteils Privatbesitz (81 %), vor allem kleinstrukturierte Familienwälder. Der öffentliche Wald wird von Bundesforsten, Gemeinden und Ländern verwaltet. Die Eigentumsverhältnisse verändern sich durch gesellschaftlichen Wandel.
3.2 Arbeitsplatz Wald
Der Wald schafft rund 20.500 Arbeitsplätze, wobei Automatisierung und Digitalisierung die Art der Arbeit verändern. Es besteht Bedarf an Fachkräften, besonders bei Waldschutz und im Forstbetrieb, mit Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Attraktivität der Branche.
3.3 Holz wird in Österreich nachhaltig genutzt
Holz ist ein bedeutender Rohstoff in der Industrie, Energie und Bau. Österreich verarbeitet jährlich Millionen Festmeter Holz, überwiegend aus heimischen Wäldern. Der Anteil an energetischer Nutzung wächst, mit Fokus auf erneuerbare Energieträger.
3.4 Forstwirtschaft schafft regionale Wertschöpfung
Die Branche trägt wesentlich zur Wirtschaft bei, mit einem Produktionswert von rund 12 Mrd. Euro und breiter Beschäftigung. Die nachhaltige Nutzung sichert Arbeitsplätze, fördert die regionale Wertschöpfung und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.
3.5 Österreich handelt mit der Welt
Österreich exportiert mehr Holzprodukte, als es importiert, vor allem nach Europa. Der Import umfasst Rohholz und Nebenprodukte, während Exporte vor allem hochverarbeitete Produkte sind. Die Exportquote steigt ständig, was die Bedeutung der Holzindustrie unterstreicht.
3.6 Der digitale Wald
Digitalisierung revolutioniert die Forstwirtschaft durch Fernerkundung, Satelliten, Laserscanning und intelligente Maschinen. Diese Technologien ermöglichen effizientere Waldnutzung, Überwachung und Planung sowie den Schutz vor Naturgefahren.
Kapitel 4 Wald und Gesellschaft
Dieses Kapitel beleuchtet den gesellschaftlichen Nutzen des Waldes, Grünraum in Städten, Waldpädagogik, Konflikte und Maßnahmen zur Konfliktlösung sowie die Bedeutung von Wald für die Erholung und das soziale Miteinander.
4.1 Wald für den Mensch
Der Wald bietet Erholung, Wissensvermittlung, Naturerlebnis und gesundheitsfördernde Angebote wie Green Care. Urban Forestry verbindet Stadt und Wald, schafft Lebensräume und fördert die gesellschaftliche Akzeptanz sowie den Naturschutz.
4.2 Wald oder Smartphone?
Waldpädagogik und Wissensvermittlung sind für alle Altersgruppen konzipiert, um das Bewusstsein für die Bedeutung des Waldes zu fördern. Citizen Science und barrierefreie Zugänge bieten Beteiligung und Wissen für die breite Öffentlichkeit.
4.3 Waldbrand: überwiegend menschengemacht
Etwa 85 % der Waldbrände entstehen durch menschliche Aktivitäten wie Feuer, weggeworfene Zigaretten oder Lagerfeuer. Prävention, Waldschutzmaßnahmen und Aufklärung sind entscheidend, um Schäden zu vermeiden und die Einsatzkräfte zu unterstützen.
4.4 Frauen im Forstsektor
Der Frauenanteil im Forst ist niedrig, steigt aber langsam. Ursachen sind gesellschaftliche Rollenbilder, Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie ungleichen Ausbildungsanteile. Initiativen fördern Gleichstellung und Sichtbarkeit.
4.5 Begegnungen im Wald: Wer darf was?
Der Konflikt zwischen Nutzern und Besitzern sowie zwischen Naturschutz und Wildtiermanagement erfordert Dialoge und gemeinsame Lösungen. Aufklärung und Verständnis sind Schlüssel, um Konflikte zu minimieren.
4.6 Mehr Bäume für die Stadt
Urban Forestry trägt zur Klimaanpassung, Verbesserung der Luftqualität und Erholung bei. Es ist wichtig, stressresistente Baumarten zu pflanzen, die Gehölzflächen zu erweitern und das Stadtklima aktiv zu gestalten.
Wir gestalten die Wälder der Zukunft: nachhaltig und partizipativ
Der Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ist essenziell für eine nachhaltige Zukunft. Partizipation, Forschung, Förderungen und rechtliche Rahmenbedingungen sichern die Entwicklung adaptiver, wetterfester und biodiverser Wälder.
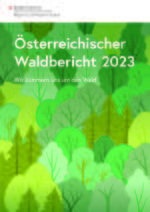
“Österreichischer Waldbericht 2023” (de)
Seitenanzahl: 67
Zielländer: Österreich
Wichtige Punkte
- Österreich verfügt mit rund 48 % Waldfläche über eine der waldreichsten Flächen Europas.
- Die Waldfläche beträgt mehr als vier Millionen Hektar, nimmt weiterhin zu und ist essenziell für Klimaschutz, Biodiversität sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche Leistungen.
- Der Trend zu mehr Laubholz stärkt Biodiversität und Klimafitness der Wälder.
- Die Waldinventur zeigt einen Anstieg des Laubholzanteils, was Diversität fördert und die Widerstandskraft gegen Klimawandel und Schädlinge erhöht.
- Der nachhaltige Holzvorrat in Österreich steigt, wobei nur rund 89 % des Zuwachses geerntet werden.
- Der Holzvorrat erreicht eine Rekordhöhe von 1,18 Milliarden Festmeter, und die Bewirtschaftung folgt dem Prinzip, nicht mehr Holz zu entnehmen als nachwächst, wodurch CO₂ im Holz langfristig gespeichert wird.
- Der Klimawandel beeinflusst die Wälder durch Trockenheit, Schädlinge und veränderte Wachstumsbedingungen.
- Verlängerte Vegetationsperioden, Frostschäden und Schädlingsvermehrung gefährden die Waldgesundheit und stellen Herausforderungen für zukünftige Forstpolitik und -bewirtschaftung dar.
- Der österreichische Schutzwald ist essenziell für die Sicherheit, weist aber Verjüngungs- und Wildschadenprobleme auf.
- Auf 42 % der Waldfläche sind Schutzfunktionen notwendig, doch Wildverbiss und fehlende Verjüngung gefährden die Schutzwirkung, weshalb gezielte Maßnahmen wie das Schutzwaldzentrum umgesetzt werden.
- Der Waldfonds investiert 350 Mio. Euro in Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, Biodiversitätsförderung und nachhaltige Nutzung.
- Dieses Fördersystem soll klimaresistente Wälder, innovative Holztechnologien und regionale Wertschöpfung stärken, um die Zukunftsfähigkeit der österreichischen Forstwirtschaft zu sichern.
- Digitale Technologien wie Satelliten- und Laserscanner unterstützen die Waldüberwachung und -planung erheblich.
- Einsatz modernster Fernerkundung und Datenanalyse ermöglicht eine präzise Beurteilung des Waldzustands, Baumartenmischung und Schadensflächen, was vital für eine nachhaltige Forstpolitik ist.
Quellen
- “Österreichischer Waldbericht 2023” - 2023-03-01 - https://www.bmluk.gv.at/dam/jcr:a5c90b98-5c24-4bd6-a9f1-60cbbda8cfff/BML_broschuere_oesterreichischer_waldbericht2023_200dpi_pac3.pdf