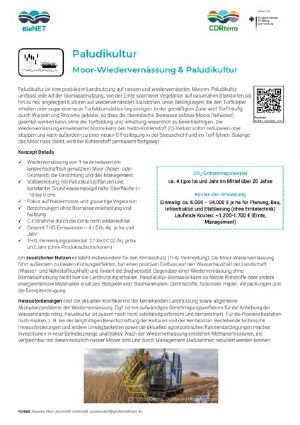Paludikultur Moor-Wiedervernässung & Paludikultur
Das Dokument behandelt die Konzeption und Potenziale der Paludikultur, also der produktiven Bewirtschaftung nasser und wiedervernässter Moore, im Kontext des Klimaschutzes, der Biodiversität und der nachhaltigen Landnutzung. Es verfolgt das Ziel, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Parameter dieser Landnutzung zu analysieren, um Strategien für die Umsetzung von Moorschutz und Kohlenstoffbindung auf landwirtschaftlichen Flächen zu entwickeln und zu fördern. Die Zielgruppe besteht vor allem aus Fachleuten in den Bereichen Umweltpolitik, Landnutzungsplanung, Naturschutz sowie Wissenschaftler, die an klima- und biodiversitätsfördernden Landnutzungskonzepten arbeiten.
Zusammenfassung
Paludikultur
Paludikultur bezeichnet eine produktive Landnutzung auf nassen und wiedervernässten Mooren, die die Erhaltung oder sogar die Zunahme des Torfkörpers unter Bedingungen fördert, die eine Torfakkumulation ermöglichen. Die Praxis umfasst Biomassenutzung von spontaner Vegetation bis zu neu angelegten Kulturen, vor allem auf Niedermooren, mit Schwerpunkt auf der Ernte von Pflanzen wie Schilf, Rohrkolben und Seggen. Die Wiedervernässung dieser Moore kann Netto-Kohlenstoffverluste sofort reduzieren oder stoppen und führt zu einer dauerhaften Kohlenstoffbindung, das Potenzial zur THG-Vermeidung liegt bei 27-36 t CO2-Äquivalenten je ha und Jahr. Die Umsetzung ist mit Herausforderungen verbunden, wie Konflikten mit bestehender Landnutzung, Genehmigungsverfahren und Akzeptanzproblemen, doch bietet sie bedeutende Vorteile für den Klimaschutz, Wasserhaushalt und die Biodiversität.
Konzept-Details und Standortbedingungen
Das Konzept umfasst die Wiedervernässung von 1 ha entwässertem landwirtschaftlich genutztem Moor, mit einem dauerhaften Grundwasserspiegel nahe der Oberfläche und vollbedecktem Bewuchs mit Paludikulturpflanzen. Fokus liegt auf Niedermooren mit grasartiger Vegetation. Frühe Studien zeigen, dass in Deutschland die Moorflächen überwiegend entwässert sind, was durch Wiedervernässung rückgängig gemacht werden kann. Die technische Umsetzung erfordert Infrastruktur wie Dämme, Wassermanagementanlagen und geeignete Bewirtschaftungstechniken. Die Standortentscheidung hängt von Bodenbeschaffenheit, Eigentumsverhältnissen und hydrologischen Gegebenheiten ab, wobei größere Flächen kosteneffizienter sind. Die Systematik berührt auch die Verfügbarkeit von Flächen, die nötigen Ressourcen sowie die technologische Reife der Verfahren.
Systemische Parameter und Kohlenstoffbilanz
Langfristig wird in Paludikultur eine Netto-Kohlenstoffbindung von etwa 4 t CO2 pro ha und Jahr erwartet, basierend auf Abschätzungen von natürlichen, nassen Mooren. Anfangs kann die C-Akkumulation in den ersten 10-15 Jahren sehr hoch sein (bis zu 40 Tonnen C pro ha), sinkt danach aber auf langfristige Raten von 0,8 Tonnen CO2 pro ha und Jahr. Die Sicherheit der langfristigen Speicherung hängt von konstant hohen Grundwasserständen ab. Risiken bestehen durch potenzielle Austrocknung, Brände oder Wasserknappheit, wobei Emissionen vor allem durch Methan und Lachgas entstehen. Das Vermeidungspotenzial liegt bei 27-36 t CO2-äquivalenten je ha und Jahr, wobei die technischen Messungen, Nachweise und Überprüfungen komplex und noch im Entwicklungsstadium sind.
Ökologische und Umweltwirkungen
Paludikultur wirkt sich positiv auf den Wasserhaushalt aus, erhöht die Wasser- und Nährstoffrückhaltung und verbessert die Wasserqualität durch Nährstoffrückhalt. Sie fördert die Biodiversität, insbesondere moortypischer Arten, und kann Lebensräume für seltene und gefährdete Arten schaffen. Die kühlenden Effekte durch erhöhte Evapotranspiration tragen zum regionalen Klima bei, wirken Hochwasser- und Erosionsschutz entgegen und verbessern die allgemeine Umweltqualität. Die Wiedervernässung mindert die Freisetzung von Nährstoffen in die Gewässer, allerdings besteht das Risiko der Phosphorfreisetzung. Insgesamt bietet eine paludikulturelle Nutzung vielfältige ökologische Vorteile bei gleichzeitiger Berücksichtigung potenzieller Risiken wie Wasserknappheit und Wasserstandsschwankungen.
Institutionelle Parameter und rechtliche Rahmenbedingungen
Die Umsetzung der Paludikultur erfordert die Genehmigung nach Wasserrecht, ggf. Planfeststellungen und die Klärung von Eigentumsrechten. Förderungen sind über die EU- und Landesprogramme möglich, jedoch stellen rechtliche, strukturelle und politische Rahmenbedingungen wie Eigentumsrechte, Subventionen und fehlende Strategien oft Hindernisse dar. Eine Unterstützung durch Umwelt- und Klimaschutzprogramme sowie Öffentlichkeitsarbeit sind entscheidend, um Akzeptanz zu fördern. Die Einbindung regionaler Akteure, die Anpassung der Verwaltung und die Entwicklung von Standards sind für eine erfolgreiche Umsetzung notwendig.
Ökonomische Parameter und Kosten
Die Kosten für die Wiedervernässung inklusive Infrastruktur und Management variieren stark, durchschnittlich werden ca. 4.000 € pro ha für Planung, Bau sowie 10.000 € für Infrastruktur genannt. Die laufenden Kosten für Betrieb und Ernte liegen bei 810 bis 1.680 € pro ha und Jahr, abhängig von der Kulturart. Die Produktion von Biomasse aus Paludikultur kann für vielfältige stoffliche und energetische Produkte genutzt werden, mit variierenden Produktivitätsraten. Die Rentabilität hängt stark von Standort, Kulturart und Marktbedingungen ab. Subventionen und Förderprogramme können die Wettbewerbsfähigkeit verbessern, bieten aber auch Herausforderungen durch politische und wirtschaftliche Unsicherheiten.
Soziale Parameter und gesellschaftliche Wahrnehmung
Der gesellschaftliche Umgang mit Wiedervernässung und Paludikultur ist geprägt von Ängsten, Vorurteilen und dem Wunsch nach Bewahrung traditionsreicher Landschaften. Viele sehen die Maßnahmen als Kulturverlust, befürchten Wertverluste oder Unannehmlichkeiten wie Mückenplagen. Offenheit für ökologische Vorteile, Beschäftigungsmöglichkeiten und Umweltbildung sind wichtig, um Akzeptanz zu erhöhen. Die gesellschaftliche Unterstützung hängt von Transparenz, Beteiligung und der Kommunikation der nachhaltigen Vorteile ab. Rechtliche und ökonomische Unsicherheiten sowie die mögliche Flächeneigentumsfrage sind zentrale Herausforderungen für die Akzeptanz.
Risikobewertung und Gesundheitliche Auswirkungen
Risiken bestehen vor allem durch Feuchteschäden an Infrastruktur, Wasserhaushalt und mögliche Konflikte mit anderen Nutzungen. Technische Herausforderungen und unzureichende Demonstrationseinrichtungen erhöhen Unsicherheiten. Positiv wirkt die Moor-Wiedervernässung auf die menschliche Gesundheit durch lokale Kühlung, Wasserreinigung und die Reduktion von Schadstoffen im Wasser. Es besteht jedoch die Gefahr, dass durch die gesteigerte Wasseraktivität Mücken als Krankheitsüberträger zunehmen könnten. Insgesamt erfordert die Anwendung der Paludikultur eine sorgfältige Planung und Überwachung, um Risiken zu minimieren.

Paludikultur Moor-Wiedervernässung & Paludikultur (de)
Seitenanzahl: 41
Zielländer: Deutschland
Wichtige Punkte
- Wiedervernässung von Mooren ist eine effektive Maßnahme zur Reduktion von THG-Emissionen
- Die Wiedervernässung entwässerter Moore kann den Netto-Kohlenstoffverlust sofort reduzieren oder stoppen, das Kohlenstoffspeicherpotenzial dauerhaft sichern und mit THG-Vermeidungspotenzialen von 27-36 t CO2-Äq. je ha und Jahr einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
- Paludikultur verbindet Produktion mit Klimaschutz und Biodiversitätsförderung
- Durch die kulturelle Nutzung nasser Moore, wie Schilf und Rohrkolben, können Treibhausgasemissionen reduziert sowie nachhaltige Stoffe und Energie erzeugt werden, wobei langfristige C-Akkumulation und die Erhaltung der Moorökosysteme gewährleistet sind.
- Technische und gesellschaftliche Herausforderungen limitieren die Skalierbarkeit
- Konflikte mit bestehender Landnutzung, Bewilligungsverfahren, Akzeptanzprobleme sowie Unsicherheiten hinsichtlich langfristiger Rentabilität und technischer Machbarkeit hemmen die breite Implementierung von Paludikultur und Moorwiedervernässung.
- Große Flächen und geeignete Infrastruktur sind entscheidend für erfolgreiche Projekte
- Effektive Wiedervernässung und Paludikultur benötigen Flächen von mindestens 10 ha sowie Investitionen in Wasser- und Erntetechnik, wodurch Kosten, Planung und rechtliche Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle spielen.
- Methanemissionen und Wasserstandsmanagement sind zentrale Einflussgrößen
- Methanemissionen aus wiedervernässten Mooren sind vergleichbar mit natürlichen Mooren, schwanken stark, und deren Reduktion erfordert kontolliertes Wasserstandsmanagement, um sowohl Klimaziele als auch ökologische Stabilität zu sichern.
- Ökonomische Risiken und fehlende politische Rahmenbedingungen erschweren Investitionen
- Aktuelle Subventionen, rechtliche Hürden und Unsicherheiten bei Rentabilität und Marktfähigkeit der Biomasse stellen bedeutende Barrieren dar, die eine flächendeckende Umsetzung von Paludikultur erschweren.
- Öffentlichkeitsarbeit und Stakeholder-Beteiligung sind für Akzeptanz essenziell
- Erfolgreiche Umsetzung erfordert transparente Kommunikation, Umweltbildung sowie die Einbindung der Landnutzenden und regionalen Akteure, um Konflikte zu minimieren und die gesellschaftliche Unterstützung zu erhöhen.
Quellen
- Paludikultur Moor-Wiedervernässung & Paludikultur - - https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00057111/PC_Paludikultur.pdf